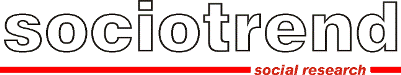Die Conjoint-Analyse in der Praxis der Markt- und Sozialforschung
Es gibt eine Vielzahl von verständlichen theoretischen Darstellungen der Conjoint-Analyse und ihrer Funktionsweise. Auf dieser Seite möchten wir einige der Fragen beantworten, die uns in vielen Jahren von Kundenseite immer wieder gestellt worden sind. Wir haben die Antworten so formuliert, dass sie schnell auf den Punkt kommen und eindeutige Aussagen beinhalten. Das geht mitunter auf Kosten einer ebenfalls wünschenswerten Differenziertheit. Wir glauben jedoch, dass für den Praktiker klare Antworten wichtiger sind, als ein unverbindliches Abwägen endloser Für und Wider.
Möge diese Zusammenstellung Ihnen helfen, Ihr Conjoint-Projekt besser zu planen! Wir raten jedoch davon ab, diese Seite als Do-it-yourself-Anweisung misszuverstehen und als unerfahrener Nutzer, Conjoint-Studien selbst zu konzipieren und durchzuführen. Zu viele sind die Fallstricke, und schnell hat man für teures Geld wertlose Daten gesammelt.
Was ist der Grundgedanke der Conjoint-Analyse?
Bei der Conjoint-Analyse werden Produkte oder Dienstleistungen in ihre Teileigenschaften oder Komponenten zerlegt. Dabei kann man sich auf einen Teil der möglichen Produkteigenschaften beschränken. Nicht berücksichtigte Eigenschaften werden als für alle Produkte konstant (gleich) angesehen.
Den Befragten werden immer neue Kombinationen dieser Eigenschaften vorgelegt. Diese Eigenschaftskombinationen stellen mögliche (zum großen Teil auch neue) Produkte dar. Meist muss sich der Proband lediglich zwischen mehreren Produktalternativen entscheiden. Hierbei werden keine skalierten Urteile, sondern nur diskrete Entscheidungen verlangt. Aus diesen Entscheidungen wird in der Auswertungsphase der Conjoint-Analyse dann der Nutzen der einzelnen Produkteigenschaften ermittelt. Es wird angenommen, dass sich der Gesamtnutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung aus den aufaddierten Einzelnutzen seiner Teileigenschaften oder Komponenten zusammensetzt.
Ein Conjoint-Modell besitzt also immer eine hierarchische Struktur aus Merkmalen (Attributen) und Merkmalsausprägungen (Attribute-Level). So kann z.B. der Preis ein Attribut des Produktes sein. Die Ausprägungen des Attributs 'Preis' wären konkrete Preisstufen (etwa: 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro). Ein anderes Merkmal könnte die Farbe einer Verpackung sein mit den Ausprägungen rot, blau, grün.
Wesentlich bei jeder Conjoint-Modellentwicklung ist die Identifikation und Festlegung dieser Merkmale und Merkmalsausprägungen.
Wann sollte ich die Conjoint-Analyse einsetzen?
Eine Conjoint-Analyse sollte dann eingesetzt werden, wenn ich komplexe Produkte oder Dienstleistungen habe, die sich aus mehreren Teileigenschaften zusammensetzen bzw. in solche zerlegt werden können. Darüber hinaus sollte es zu diesen Eigenschaften Alternativen geben (so könnte das Display eines MP3-Players verschiedene Auflösungen und Größen haben). Die Conjoint-Analyse ermittelt den relativen Wert jeder dieser Eigenschaften (Teilnutzen) und kann den optimalen Preis für das jeweilige Gesamtprodukt (Summe aller Teilnutzen) ermitteln. Wesentlich für die Conjoint-Analyse ist also das Vorhandensein einer hierarchischen Merkmalsstruktur.
In den allermeisten Fällen stellt man sich bei der Conjoint-Analyse die Frage nach Preisen (Gesamtpreise oder Preise für Teilleistungen bzw. für einzelne Produktkomponenten). Dennoch gibt es Fragestellungen, bei denen Preise keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Hier kann die Conjoint-Analyse helfen, die Präferenzstruktur der Zielgruppe zu identifizieren oder spezifische Eigenschaftsbündel von Produkten zu definieren. So kann bei einem neuen Produkt ermittelt werden, welche Produkteigenschaften für den Kunden wirklich wichtig sind, so dass man ggf. weniger relevante Produktmerkmale weglassen und somit einsparen kann.
Welche Alternativen gibt es zur Conjoint-Analyse?
Die wichtigsten Alternativen zur Conjoint-Analyse sind Preisfindungsmethoden geringer und mittlerer Reichweite wie das Van Westendorp-Preismodell (Price Sensitivity Meter) oder die Methode des Brand-Price-Tradeoffs (BPTO). Beide Vorgehensweisen führen zu relevanten Preispunkten und ermöglichen auch die Berechnung einfacher Preis-Absatz-Funktionen. Im Gegensatz zum Conjoint wird aber jedes Produkt hier als Ganzes betrachtet. Eine Aufschlüsselung in einzelne Teilnutzen, also die Betrachtung einzelner Produkteigenschaften ist nicht möglich.
Ein anderes Verfahren, das in den letzten Jahren an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen hat, stellt die Methode des Maximum Difference Scalings dar. Wie beim Conjoint erhält man auch hier die Nutzenwerte einer Vielzahl von Produkteigenschaften. Diese werden allerdings als gleichberechtigte Eigenschaften interpretiert. Technisch gesprochen, besitzen die Merkmale bei der MaxDiff-Methode keine explizite hierarchische Struktur. So könnte man beispielsweise fragen, welche Ausstattungsmerkmale man sich bei einem Neufahrzeug wünscht. Die Verwendung von Preisen ist möglich, allerdings ist diese im Vergleich zur Conjoint-Analyse deutlich eingeschränkt.
Ein neueres, alternatives Verfahren, was die Conjoint-Analyse allerdings an Kosten z.Z. noch übertrifft, ist das Menu-Based-Choice-Verfahren (MBC). Hier stellt sich der Befragte sein Wunschprodukt selbst zusammen (beispielsweise ein Mittagessen aus der Menukarte eines Restaurants). Bei dieser Methode werden die Preise der einzelnen Menubestandteile systematisch variiert. Die Ergebnisse sind mit denen klassischer Conjoint-Analysen vergleichbar. Zudem wird in der Regel eine geringere Anzahl an Darbietungen benötigt, was Durchführungszeit spart. Diese Methode ist noch in der Entwicklung. Außerdem eignet sie sich nicht für alle typischen Fragestellungen der Conjoint-Analyse.
Wen kann ich befragen?
In aller Regel muss eine Conjoint-Studie computergestützt durchgeführt werden. Dies hat einige Implikationen. Auch wenn es schriftliche Verfahren der Conjoint-Durchführung gibt, so sind diese nur im Ausnahmefall sinnvoll. Zu groß ist der Verlust an Designqualität und Befragungsmöglichkeiten. Eine rein telefonische Durchführung ist, wenn überhaupt, nur bei sehr einfachen Modellen (zwei bis drei Attribute mit leicht verständlichen Ausprägungen) möglich. Und bei grafischem Material ist eine optische Unterstützung natürlich unabdingbar.
Computergestützt lassen sich Conjoint-Studien online und CAPI (Inhome oder Studio) einsetzen. Manchmal kombiniert man den telefonischen und Online-Zugang derart, dass man die Befragten im Laufe eines telefonischen Interviews auf eine Webseite führt, die die Conjoint-Sequenz enthält. Das ist jedoch meist B2B-Studien vorbehalten.
Ein günstiges Verfahren der Stichprobengewinnung ist die Rekrutierung aus dem eigenen Kunden- oder Adressbestand. Diese Personen können per Email zu einer Online-Studie eingeladen werden und füllen diese dann selbsttätig aus. Auch eine Verlinkung mit der eigenen Webseite ist manchmal sinnvoll. Bei dieser Vorgehensweise sollte aber stets darauf geachtet werden, ob sie nicht zu unerwünschten, systematischen Verzerrungen der Ergebnisse führt (so werden die eigenen Kunden meine Firma sicherlich anders wahrnehmen als die Gesamtheit meiner potentiellen Kunden).
Ein mittlerweile gängiges und relativ preiswertes Verfahren, geeignete Studienteilnehmer zu gewinnen, stellen Online-Access-Panels dar. Diese gibt es mittlerweile zahlreich. Oft können sie Teilnehmer weltweit zur Verfügung stellen und aus einer Hand anbieten. Die Auswahl eines geeigneten Online-Panels übernimmt für Sie Ihr durchführendes Institut. Hier sollten Sie unbedingt nachfragen, welche Verfahren der Qualitätssicherung zur Anwendung kommen. Ähnliches gilt für CAPI-Felder und für bundesweit agierende Studioinstitute, die Teilnehmer ad hoc rekrutieren. In der Regel werden letztere aber deutlich teurer sein.
Welche Stichprobengröße brauche ich für eine Conjoint-Studie?
Diese Frage ist natürlich besonders schwer zu beantworten. Der Conjoint-Software-Anbieter Sawtooth schreibt etwas salopp: "Wie kennen keine wirklich gute Conjoint-Studie, die mit weniger als 800 Befragten auskommt." Das ist für die Praxis sicher wenig hilfreich.
Gerade im B2B-Bereich gibt es Märkte, in denen die (weltweite!) Grundgesamtheit kaum ein paar Hundert Einheiten umfasst. In solchen Märkten ist man dann hochzufrieden, wenn man 50 Personen zur Teilnahme an einer Studie bewegen kann. Und auch bei großen Stichproben besteht manchmal die Notwendigkeit, diese so weit herunter zu brechen, dass die zu betrachtende Einheit kaum größer ist.
Grundsätzlich hängt die Stichprobengröße von drei Faktoren ab: Von der Anzahl der Ausprägungen des 'längsten' Merkmals, also die maximale Anzahl der Stufen (Ausprägungen), die ein Merkmal in einem Conjoint-Modell hat. Hierbei spielt es keine Rolle, wenn die restlichen Merkmale besonders kurz sind. Darüber hinaus wird die notwendige Stichprobengröße von der Anzahl der gezeigten Conjoint-Tasks und der in einem Task gezeigten Produkte beeinflusst. Das gilt in dieser Form zwar nur für ein CBC-Modell, findet aber auch in den anderen Conjoint-Verfahren Entsprechungen. Ein 'längeres' Attribut muss also z.B. durch einen größeren Stichprobenumfang, mehr Conjoint-Aufgaben oder einer Erhöhung der Anzahl der simultan gezeigten Produkte erkauft werden, um eine vergleichbare Fehlerrate zu erreichen wie bei einem 'kürzeren' Merkmal. Ähnliches gilt für die Erhöhung oder Verringerung der anderen Parameter.
Es ist sinnvoll, Conjoint-Modelle vorab zu testen, um das ökonomischste Verhältnis dieser gegenläufigen Modelleigenschaften zu finden.
Welches Conjoint-Verfahren sollte ich wählen?
Es gibt eine Vielzahl von Conjoint-Verfahren. Manchmal handelt es sich hierbei und universitäre Spezialentwicklungen (wie die LCA oder HLCA), die keine internationale Bedeutung haben und für die Praxis kaum eine Rolle spielen. Manchmal handelt es sich um Eigenentwicklungen von Instituten, deren blumige Namen darüber hinwegtäuschen, dass dahinter oft nur eine bescheidene Methodik steckt. Auf jeden Fall sollten Sie sich bei der Auswahl eines Instituts danach erkundigen, welche Softwareplattform verwendet wird und welche Verfahren diese ermöglicht. Nicht selten bleiben sinnvolle Verfahren unberücksichtigt, wenn sie von der eingesetzten Software nicht unterstützt werden.
Für die Praxis spielen folgende drei Conjoint-Verfahren eine nennenswerte Rolle: ACA (Adaptive Conjoint-Analyse), CBC (Choice-Based-Conjoint) und ACBC (Adaptives Choice-Based-Conjoint). Wobei aktuell ca. 70% aller Conjoint-Studien auf CBC entfallen. ACBC stellt eine neue Methode dar, die nur von wenigen Instituten angeboten wird.
Die Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren ist v.a. von der zur Verfügung stehenden Durchführungszeit, von der Anzahl der notwendigen Merkmale und vom Conjoint-Design selbst anhängig. Während ein CBC-Modell meistens nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, dauert das Ausfüllen der ACBC-Aufgaben 10 bis 15 Minuten, bei der ACA gar 20 Minuten oder länger. Ein Choice-Based-Conjoint (CBC), in dem alle Produktmerkmale gleichzeitig dem Probanden gezeigt werden, ist nur so weit sinnvoll, als die Fülle des Materials vom Probanden kognitiv verarbeitet werden kann. Das werden in der Regel fünf bis sieben Merkmale sein, nur im Ausnahmefall mehr. Sehr große Modelle erfordern eine Adaptive-Conjoint Analyse (ACA). Enthält ein Conjoint-Design verschachtelte Attributstrukturen (ein Merkmal ist der Ausprägung eines anderen Merkmals untergeordnet - z.B. gibt es Batterieladezeiten nur beim Elektroauto, aber nicht beim Benziner) kommt man um das CBC nicht herum. Nur dieses Verfahren ermöglicht komplexere Attributstrukturen. Das ACBC wird man eher bei mittelgroßen Modellen wählen (acht bis zwölf Merkmale), deren Design vollständig ist oder bei denen spezielle Preisattribute notwendig erscheinen (Summed Price-Option).
Natürlich gibt es noch eine ganze Fülle anderer Kriterien, die die Auswahl des geeigneten Conjoint-Verfahrens bestimmten. Hier ist eine eingehende Beratung durch den Anbieter notwendig.
Wie viele Merkmale und Merkmalsausprägungen sind sinnvoll?
Ein Conjoint-Modell bedarf mindestens zweier Merkmale, und jedes Merkmal mindestens zweier Merkmalsausprägungen. Ohne die Möglichkeit, etwas zu variieren, ist keine Conjoint-Analyse durchführbar.
Die Anzahl der technisch möglichen Merkmale und Merkmalsausprägungen ist softwareabhängig. Diese Grenzen sind für die Praxis aber weniger von Belang, weil sie meist so angelegt sind, dass man sie nicht ausschöpft. Dennoch gibt es Software-Module, die maximal zehn Attribute zulassen. Diese Anzahl mag zwar für eine klassische CBC-Studie mehr als ausreichend sein, für einige Fragestellungen ist sie aber eindeutig zu klein.
Entscheidender als die technische Obergrenze ist die kognitive Verarbeitungskapazität der Befragten. Es bringt wenig, hochkomplexe Modelle zu bauen, wenn der Proband sich dann notgedrungen auf zwei oder drei saliente Attribute konzentriert. Gerade bei vollständigem Design im CBC oder ACBC können acht Attribute oder mehr den Befragten überfordern.
Als Faustregel gilt: Bis zu sieben Attribute lassen sich gut mit einem CBC-Modell bearbeiten, fünf bis zehn Attribute stellen eine handhabbare Menge im ACBC dar, und ein ACA-Modell fängt mit sechs oder sieben Attributen an, interessant zu werden. Aber das sind natürlich nur ungefähre Werte.
Die Anzahl der Merkmalsausprägungen sollte so gering wie möglich gehalten werden. Das gilt gerade für kontinuierliche ('metrische') Attribute wie Preis, Gewicht, Größe etc. Vier oder fünf Stufen reichen hier meistens aus, da man Zwischenwerte in der Simulation interpolieren kann. Wichtig ist aber, dass man den gesamten relevanten Wertebereich (Range) abdeckt. Extrapolieren kann (sollte) man nämlich nicht.
Sehr lange Attribute, also Attribute mit vielen Ausprägungen, gehen auf Kosten der Modellgüte, da die jeweilige Ausprägung umso seltener den Probanden gezeigt wird, je mehr Abstufungen das Merkmal hat. Das führt zu ungenaueren Schätzungen (die über eine größere Fallzahl oder mehr Tasks bzw. mehr Produktdarbietungen kompensiert werden müssen).
Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Sehr einfache CBC-Modelle können manchmal Merkmale mit 30, 50 oder mehr Ausprägungen aufweisen, wenn ganze Produkte lediglich im Preis variiert werden. In einem solchen Pseudo-Regaltest sieht man dann auf jedem Screen eine ganze Reihe von Produkten, aus denen man das jeweils attraktivste auswählen kann.
Insgesamt gilt: Man kann nicht alle Fragestellungen mit einem Conjoint-Modell 'erschlagen'. Weniger ist oft mehr. Es ist besser, mehrere kleinere Conjoint-Modelle zu konzipieren, als ein einziges riesiges Meta-Modell zu bauen.
Was muss ich bei der Auswahl der Merkmalsausprägungen beachten?
Da die Anzahl der Ausprägungen eines Merkmals wesentlichen Einfluss auf die Modellkomplexität hat, sollte diese stets so gering wie möglich gehalten werden. Zwei bis fünf Attribute-Level dürften für die allermeisten Merkmale ausreichen.
Gerade bei kontinuierlichen, 'metrischen' Merkmalen, wie Preis, genügen häufig wenige Ausprägungen, da Zwischenwerte in der Simulation interpoliert werden können. Wesentlich ist aber, dass die Spannweite der interessierenden Werte abgedeckt wird, da Werte außerhalb dieser Spanne nicht extrapoliert werden können.
Ein weiteres notwendiges Merkmal bei der Auswahl der Merkmalsausprägungen ist ihre logische Unvereinbarkeit. Merkmalslevel sollten sich stets gegenseitig ausschließen. Man kann einen Probanden z.B. nicht fragen, ob er ein Auto mit Klimaanlage oder mit Ledersitzen will. Es wäre ja denkbar, dass er beide Ausstattungselemente wünscht. In diesem Fall könnte man die Ausstattungsfeatures auf zwei Merkmale verteilen (mit den jeweiligen Ausprägungen 'vorhanden' und 'nicht vorhanden') oder ein kombiniertes Merkmal konstruieren mit den Ausprägungen 'nur Klimaanlage', 'nur Ledersitze' sowie 'Klimaanlage und Ledersitze'.
Wann sind Ausschlüsse von Kombinationen von Merkmalsausprägungen sinnvoll?
Während der Kunde häufig den Wunsch nach Ausschluss 'irrelevanter' oder 'trivialer' Produktalternativen aus dem Conjoint-Design wünscht, ist, vom methodischen Standpunkt aus gesehen, jeder Ausschluss schädlich und möglichst zu vermeiden.
Technisch betrachtet, führen Ausschlüsse in der Regel zu unerwünschten Abflachungen der Nutzenwertverläufe der betroffenen Attribute. Das gilt gerade, wenn man niedrige Preise mit 'guten' Produkten und, umgekehrt, hohe Preise mit 'schlechten', weil einfachen Produkten ausschließt. Dem Betrachter oder dem Probanden erscheinen diese Produktentscheidungen zwar als trivial (Warum sollte man ein teureres Produkt wählen, wenn daneben ein besseres Produkt zu einem günstigeren Preis angeboten wird?), der Computer bzw. die Auswertungssoftware braucht diese Informationen aber, um adäquate Nutzenwerte berechnen zu können. Fehlen diese, kommen falsche Schätzungen zustande.
Ausschlüsse sollten auch keine 'realen' Marktverhältnisse widerspiegeln wollen. So könnten Produkte, die es heute (noch) nicht gibt, morgen von jemandem (oder von einem selbst!) angeboten werden.
Einzig, wo es darum geht, logische Unvereinbarkeiten zu vermeiden, sollten Ausschlüsse zwischen den Ausprägungen von Merkmalen definiert werden. Das wird in der Praxis jedoch eher selten vorkommen.
Was sind unvollständige oder geschachtelte Designs?
Normalerweise werden alle Attribute in einem vollständigen Design miteinander kombiniert, d.h. jede Merkmalsausprägung erscheint in den Conjoint-Aufgaben irgendwann mit jeder anderen Ausprägung. Daran ändern auch einzelne Ausschlüsse nichts. Sie stellen lediglich Ausnahmen, ähnlich einem blinden Fleck, im Conjoint-Design dar.
Das CBC-Verfahren bietet aber zusätzliche Möglichkeiten der Design-Konstruktion. So kann ein großes Conjoint-Modell mit Hilfe des Partial Profile-Ansatzes in mehrere kleinere Conjoints aufgesplittet werden. Hierbei können einzelne Attribute über alle Befragten konstant bleiben. Andere Attribute können rotierend dargeboten werden, was die kognitive Komplexität der Aufgaben deutlich reduziert und dadurch komplexere Conjoint-Modelle ermöglicht. Allerdings hat diese Vorgehensweise erhebliche methodische Implikationen, die vorab bedacht werden müssen.
Eine weitere gängige Alternative zum Full Profile-Conjoint sind geschachtelte (nested) CBC-Designs. Hierbei werden ganze Attribute einer einzelnen oder mehreren (aber nicht allen) Ausprägung(en) eines anderen Merkmals untergeordnet. Beispielsweise könnte ein Merkmal 'Verkehrsmittel für die Fahrt zur Arbeit' lauten. Angenommen, die Ausprägungen dieses Merkmals wären Fahrrad, Auto und ÖPNV, so müsste man das neue Merkmal 'Parkgebühren' einzig und allein der Ausprägung 'Auto' zuordnen, weil Parkgebühren bei den anderen beiden Ausprägungen 'Fahrrad' und 'ÖPNV' gar nicht anfallen. Eine Parkgebühr (mit den entsprechenden Abstufungen) würde also bei den Conjoint-Aufgaben immer nur im Zusammenhang mit der Fahrgelegenheit 'Auto' erscheinen.
Nicht jede CBC-Software unterstützt diese fortgeschrittenen Designverfahren.
Wie viele Conjoint-Aufgaben (Tasks, Screens) brauche ich?
Bei allen gängigen CBC-Verfahren gibt es die Möglichkeit, die Anzahl der Auswahlaufgaben zu beeinflussen. Das gilt auch für ACA und ACBC, wenn auch in geringerem Maße als beim klassischen CBC. Wir beschränken uns bei dieser Betrachtung auf das verbreitetere CBC.
Ein normales CBC wird üblicherweise 12 bis 15 Auswahlscreens haben. Studien zeigen, dass man ohne Qualitätsverlust bis zu 20 Aufgaben einsetzen kann. U.E. hängt das aber wesentlich von der Erhebungsmethode, der Produktkategorie und der erwarteten Motivation der Teilnehmer ab.
Außerdem muss auch die Anzahl der Produkte pro Screen berücksichtigt werden. Eine Wahlsituation zwischen zwei Produkten kann häufiger wiederholt werden (weil sie für den Probanden leichter ist), als eine Wahlsituation zwischen acht, zehn oder mehr Produkten.
Grundsätzlich nimmt der Schätzfehler mit wachsender Aufgabenanzahl ab. Da aber dieser Fehler auch von anderen Faktoren abhängt (Modellkomplexität, Anzahl der Produkte pro Screen und Stichprobengröße), kann ein Tradeoff zwischen diesen miteinander verbundenen Teilaspekten eines Conjoint-Designs vorgenommen werden. So kann man bei größeren Stichproben und einfacheren Conjoint-Modellen mit weniger Aufgaben auskommen (und umgekehrt).
Was ist eine No Choice-Option?
Anders als beim ACA kann man beim CBC oder ACBC auch eine sogenannte No Choice-Option verwenden. Mit ihrer Hilfe kann ein weiterer Nutzenwert berechnet werden, nämlich der Nutzen, überhaupt kein Produkt zu kaufen. Diese Alternative steht dem Käufer ja immer frei, und es entspricht der Realität, eine solche Option in ein Simulationsmodell mit einzubeziehen.
Beim CBC kann man die No Choice-Option als gleichberechtigte Alternative zu den gezeigten Produkten einsetzen. Methodisch besser ist ihre nachgeschaltete Verwendung, also den Probanden nach getroffener Entscheidung jeweils zu fragen, ob er das gewählte Produkt im 'wirklichen Leben' tatsächlich kaufen würde (Dual Response None).
Verwendet man eine No Choice-Option kann man in der Simulation Produkte auch einzeln gegen diese Option laufen lassen und damit eine Art absolute Kaufschwelle simulieren. Aber auch in komplexeren Marktszenarien macht die Nicht-Kauf-Alternative oft Sinn. Grundsätzlich kann man im Simulator diese Option aber ausschalten, so dass einem alle Möglichkeiten offen stehen.
Was sind Fixed Tasks?
Fixed Tasks oder Hand-out-Tasks sind Screens bzw. Auswahlaufgaben (beim CBC), die nicht vom Computer nach dem Conjoint-Designplan generiert, sondern manuell vom Versuchsleiter definiert werden. Im Gegensatz zu den individualisierten anderen Screens bekommt hierbei jeder Befragte die gleichen Produktalternativen gezeigt. Fixed Tasks gehen im Normalfall nicht in die Nutzenwertberechnung (Conjoint-Auswertung) ein.
Mit einer vordefinierten Auswahlaufgabe können spezifische Entscheidungssituationen nachgestellt und mit den späteren Simulationsergebnissen verglichen werden. Sie dienen also der Validierung und ggf. auch der Kalibrierung des Nutzenwertmodells.
Warum sind individuelle Nutzenwerte wichtig?
Bis vor nicht allzu langer Zeit bot einzig die Adaptive Conjoint-Analyse die Möglichkeit, individuelle Nutzenwerte zu berechnen. Das hat sich zwischenzeitlich durch die HB-Schätzmethode (Hierarchical Bayes) für CBC und ACBC grundlegend geändert. Diese Schätzmethode ist mittlerweile zu einem Standard in der Auswertung avanciert. Achten Sie bei der Beauftragung Ihrer CBC- oder ACBC-Studie darauf, dass eine solche Auswertungsmethode Bestandteil des Angebotes ist.
Fehlen individuelle Nutzenwertschätzungen, werden Nutzenwerte nur für ganze Gruppen berechnet. Das hat entscheidende Nachteile. So ist es manchmal interessant, das Simulationsergebnis einzelner Personen zu betrachten, also nachzuvollziehen, welche Alternative sie mit welcher Wahrscheinlichkeit gewählt haben oder hätten. Noch wesentlicher erscheint aber die Möglichkeit, weitergehende multivariate Analysen auf Basis der Nutzenwerte durchführen zu können. So kann man auf ausgehend von individuellen Nutzenwerten Marktsegmentierungen durchführen und Typologien entwickeln.
Was ist das 'beste' Produkt?
Die Frage nach dem 'besten' Produkt ist meist sinnlos oder trivial. Es ist das Produkt, das alle nützlichen Produkteigenschaften auf sich vereint und wenig oder gar nichts kostet. Niemand möchte ein solches Produkt auf den Markt bringen. Nur in wenigen Studien kennt man die Nützlichkeit der Produkteigenschaften vorher nicht. So ist das Ziel der Conjoint-Analyse v.a. die genaue Quantifizierung dieses Nutzens. Manchmal variieren aber die Nutzenwerte zwischen den Befragten so stark, dass es sich lohnt, für verschiedene Zielgruppen verschiedene Idealprodukte zu konzipieren.
Das beste Produkt ist jenes Produkt, das maximalen Umsatz oder, besser noch, maximalen Gewinn verspricht. Die entscheidende Variable ist der Preis. Welcher Preis garantiert mir bei einer bestimmten Konstellation der Produkteigenschaften in einem spezifischen Marktumfeld den maximalen Umsatz (Gewinn)? Diese Preispunkte lassen sich durch Marktsimulationen bestimmen.
Was kann ich mit einem Conjoint-Simulator simulieren?
Der Stellenwert eines Produktes oder einer Dienstleistung kann nie isoliert betrachtet werden. In diesem Sinne gibt es keine 'idealen' Produkte. Der Gesamtnutzen eines Produkts muss stets ins Verhältnis zu einer Produktalternative gestellt werden. Deshalb sind Simulationen bei der Conjoint-Analyse unabdingbar. Das ist leicht nachzuvollziehen: Wenn es nur ein Produkt im Markt gibt und ich gezwungen bin, es zu kaufen, dann werde ich es tun, gleichgültig was es kostet oder welchen Nutzen ich davon habe.
Mindestvoraussetzung an eine Simulation ist also der Vergleich meines ausgewählten Produktes mit der Alternative 'Ich kaufe es nicht' (No Choice-Option). Erst dadurch habe ich die Freiheit der Wahl in mein Simulationsmodell eingebaut. In der Regel werde ich aber komplexere Marktsimulationen brauchen, um optimale Preise für meine Produkte und deren Eigenschaften zu finden. Ich brauche dafür also Alternativprodukte. Diese können Produkte aus dem eigenen Portfolio oder Produkte von Wettbewerbern sein. Der Conjoint-Simulator berechnet für jedes Produkt im Marktszenario die voraussichtlichen Wahlanteile (Marktanteile). Diese kann ich mit den ausgewählten Preisen multiplizieren und erhalte so z.B. Umsätze. Durch eine systematische Variation der Preise kann ich Preis-Absatz-Funktionen berechnen und daraus Maxima bestimmen. Diese zeigen mir die 'optimalen' Preise.
Natürlich kann ich bei einer Marktsimulation, neben dem Preis, auch andere Produktmerkmale systematisch variieren. Zum Beispiel kann ich 'nützliche' Produkteigenschaften hinzufügen und berechnen, um wie viel höher der Preis sein kann, um meinen Marktanteil zu halten (oder umgekehrt). Das ist der Ausdruck des 'Geldwertes' einer bestimmten Produkteigenschaft. Ihr Nutzen lässt sich so unmittelbar in Euro und Cent umrechnen.
Kann ich auch selbst simulieren?
Nach Abschluss einer Conjoint-Studie können neue Fragen aufkommen, die von der Studie selbst noch nicht beantwortet wurden. Vielleicht hat ein Wettbewerber seine Produkte verändert oder ihre Preise, vielleicht wurden für die eigenen Produkte zwischenzeitlich neue Features entwickelt. Unter der Voraussetzung, dass alle entscheidenden Merkmale bereits in der durchgeführten Conjoint-Studie enthalten waren, kann man solche veränderte Szenarien auch nachträglich nachstellen und simulieren. Nicht selten sind dann bereits Monate oder gar ein Jahr vergangen.
In der Regel erhält der Kunde nach Studienende einen eigenen Conjoint-Simulator, mit dem er solche Marktsimulationen leicht selbst durchführen kann. Der Simulator enthält alle Conjoint-Daten und oft auch alle relevanten Segmentierungsvariablen, so dass gruppenbezogene Auswertungen möglich sind. Ein solcher Simulator ist nach einer kurzen Einweisung leicht zu bedienen. Er ist unternehmensweit lizensiert, so dass auf Wunsch auch andere Personen, Abteilungen oder Tochtergesellschaften damit arbeiten können.
Was kostet eine Conjoint-Studie?
Diese Frage ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Wie bei anderen Studien reicht die Spanne von einigen Tausend Euro bis zu sechsstelligen Beträgen. Grundsätzlich sind Conjoint-Studien teurer als andere vergleichbare Studien. Zum einen ist die für Conjoint-Studien notwendige Spezialsoftware sehr teuer, zum anderen gibt es nur wenige Spezialisten, die das notwendige Know-How und die notwendige Erfahrung mitbringen. Da ein Conjoint-Verfahren meist auch relativ zeitaufwändig in der Durchführung ist, schlägt sich dies zusätzlich in Form höherer Feldkosten nieder.
Ein Komplettangebot (Beratung, Modellentwicklung, Auswertung, Bericht) wird kaum unter 10.000 Euro beginnen können. Hinzu kommen die Feldkosten, die ebenfalls mehrere Tausend Euro umfassen werden. 15 bis 20 Tausend Euro erscheinen deshalb für ein kleineres Projekt angemessen. Große Institute verlangen oft deutlich mehr. Und natürlich gibt es auch hier Billiganbieter. Achten Sie unbedingt auf vernünftige Beratung. Jedes Conjoint-Modell ist anders, eine schematische Umsetzung ist in den seltensten Fällen zielführend. Schnell unterlaufen Fehler, die alle Ergebnisse wertlos machen.
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir:
Dr. Marco Lalli
sociotrend GmbH
marco.lalli(at)sociotrend.com
+49(0)6224-9217-07